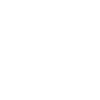Countdown
Hoi! Nur noch
mal schlafen!
Das E'hgner Narrenschiff
Es steht für das Zusammenkommen der Donau-Zünfte der VSAN und symbolisiert Gemeinschaft, Zusammenhalt und den lebendigen Austausch zwischen den Zünften entlang der Donau.
Zugleich nimmt das Narrenschiff Bezug auf die kleinen Boote der Dämonen, mit denen diese bei der traditionellen Groggentäler Ausgrabung auf dem Groggensee erscheinen – ein zentrales und stimmungsvolles Element unseres Brauchtums.
Darüber hinaus erinnert das Motiv an Jakob Locher, dessen lateinische Übersetzung des Buches „Das Narrenschiff“ im Jahr 1497 den europaweiten Erfolg dieses Werkes begründete.
Gastzünfte
- Baar
- Bodensee-Linzgau-Schweiz
- Donau
- Hegau
- Hochrhein
- Neckar-Alb
- Oberschwaben Allgäu
- Schwarzwald
- Befreundete Zünfte

Narrenzunft Bad Dürrheim
Die Dieremer Fasnet wird auf Belege närrischen Umtreibens des örtlichen Landadels im 12. Jahrhundert zurückgeführt. Im Mittelpunkt des Kurortes stand lange Zeit die Sole und die damit verbundene Salzförderung. Auf sie beziehen sich auch einige Narrenfiguren, allen voran der Salzhansel, der mit unzähligen Salzsäckchen benäht ist. In der Hand trägt er ein Salzsiederwerkzeug.
Der Bad Dürrheimer Narro ist ein klassischer Weißnarr. Wundervoll bemalt und mit den eigentümlichen Schellengurten, die parallel zu den Armen angeordnet sind. Hinzu kommen der Salzgeist, der Altnarr und natürlich der Fanfarenzug.

Narrenzunft Frohsinn 1853 Donaueschingen
Nach einer närrischen Fahrt am Fastnachtsdienstag 1853 nach Hüfingen wurde im Gasthaus Hirschen die Narrenzunft Frohsinn Donaueschingen gegründet. Von da an organisiert und pflegt die „Narrenzunft Frohsinn“ insbesondere die alte, traditionsreiche Fastnacht in Donaueschingen bis heute.
Besonders eindrücklich ist die edle Weißnarrenfigur des Hansele, das im Paar mit dem unmaskierten Gretele in Donaueschinger Sonntagstracht auftritt. In der Hand hält das Hansele dabei einen Regenschirm und einen Korb mit Gutsele zum Auswerfen..

Narrenzunft Grünwinkel Geisingen 1858
Im Jahr 1790 wurde die Aufführung eines „Faschings-Spiehls zu Geisingen“ schriftlich dokumentiert. Bereits 1858 wurde dann die Narrenzunft in einem Haus im Grünen Winkel gegründet. Daher stammt auch der Name der Zunft.
Hauptfigur ist der Hansel, ein klassischer Baaremer Weißnarr. Die kunstvollen Motive sind festgelegt und auf jedem Narr genau gleich. Der Hansel wird vom Gretele begleitet, einer Frau in der traditionellen Tracht der Baar.

Narrenzunft Strumpfkugler Immendingen 1905
Hauptfiguren der Immendinger Fasnet sind der Weißnarr Hansele und das unmaskierte Gretele. Sie führen die Narrenschar bei jedem Umzug an. Wobei das Hanselelaufen lange Tradition hat. Als Beweis dient eine alte Hanselescheme von 1830. Die Scheme ist im Heimatmuseum zu bewundern. Die erste organisierte Fasnet fand im Jahr 1905 statt.
Das Hansele trägt einen hellen, handbemalten Leinenanzug und eine geschnitzte und bemalte Glattscheme und als Zeichen seiner freiherrschaftlichen Rechte ein Schwert sowie zwei gekreuzte Schellriemen und einen Fuchsschwanz.
Seit 1954 begleitet ihn das Gretele. Ihr Häs ist mit dem hellen zylinderartigen Strohhut und der bunten Kleidung der alten Immendinger Ortstracht entnommen.

Narrenzunft Möhringen

Laternenbrüder Löffingen
Die Laternenbrüder aus Löffingen können auf eine lange Geschichte zurückblicken. Erste Fasnetshinweise reichen ins Jahr 1524/25 zurück. Der Verein gründete sich 1889 neu, Fasnachtsfiguren sind der Laternenbruder, der Hansili, der Reichburgmali und die weibliche und männliche Narrenpolizei.
Zur Grundausstattung des Laternenbruders gehört natürlich eine Laterne, ein blauer Kittel mit schwarzer Hose, ein schwarzer Rundhut und schwarze Handschuhe.

Konstanzer Blätzlebuebe-Zunft
Die Fastnachtstradition in Konstanz am Bodensee reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Die Zunft selbst wurde 1934 gegründet, einer Zeit, in der es die Narren im Land nicht leicht hatten. Hauptfigur der Konstanzer ist der Blätzlebue, ein hahnenähnlicher Blätzlenarr in gedeckten bunten Farben, einer Pritsche und einer mit Blätzle benähten Stofflarve.

Historische Narrenzunft Markdorf

Narrenzunft Fridingen
Die Fridinger Fasnet wurde schon in den 1920er Jahren ausgelassen gefeiert. Die logische Konsequenz war die Gründung der Zunft 1928.
Deren Narren ziehen buchstäblich alle an einem Strang, mehr ein dickes Seil, an dessen Ende ein Pflug hängt. Dieser wird vom Pflugheber gesteuert. Die Narrenkleider sind aus Leinen und mit Plätzle in verschiedenen Formen besetzt. Auf dem Rücken ist ein Bild mit einem Bezug zum Träger, die Jahreszahl, in der das Kleid genäht wurde. Die älteste Larve ist von 1814. Das ältestes Narrenkleid von 1856.

Narrenzunft Mühlheim
Die Hauptfiguren der Narrenzunft Mühlheim/Donau, die 1908 gegründet wurde, sind der Schellennarr, das Kiaweib und der Sagt-er.
Das aus Sackleinen genähte Narrenhäs des Schellennarrs erinnert an die Tradition der Kornmühlen in Mühlheim. Daher trägt der Schellennarr auf seiner Larvenhaube über der Maske den hölzernen Trichter eines Mahlganges. Die Figur des Schellennarrs, entstanden 1934, verkörpert den kräftigen Müllersburschen.

Trommgesellenzunft Munderkingen
Die Munderkinger Fasnet ist bekannt durch ihr einzigartiges Brauchtum: den Brunnensprung. Urkundlich erwähnt wurde die Fasnet erstmals im Jahre 1600, der Brunnensprung schon im Jahre 1742.
Der Brunnensprung wird auch heute noch in seiner fast ursprünglichen Form begangen. Zu den Klängen von Pfeifen und Trommeln tanzen zwei junge unverheiratete Burschen auf dem Brunnenrand, erheben ihre Trinksprüche und springen in das eiskalte Wasser des Marktbrunnens.

Narrenzunft Gole 1865 Riedlingen
Die Riedlinger Fasnet wurde erstmals 1505 erwähnt. 1745, wollte der Riedlinger Magistrat und eine Deputation der Bürgerschaft „masquieren“ und „Spihl-Leute“ verbieten. Das gelang zum Glück nicht und 1865 gründete sich die Narrenzunft.
Die Gole sind eine Gruppe mit riesigen Papiermaché-Masken, die verschiedene, exotisch anmutende Figuren darstellen. Der Name stammt vielleicht von „Jole“ (Schreier) oder vom biblischen Goliath. Sie werden begleitet von der Garde der Golebegleiter mit ihren grimmigen Holzmasken.

Narrenzunft Vetter Guser Sigmaringen
Der Narrenzunft Vetter Guser hat sich 1912 gegründet. Herzstück der „Semmerenger Fasnet“ ist das Historische Bräuteln. Die Bräutlingsgesellen tragen die grünen, silbernen und goldenen Hochzeiter alljährlich auf einer Stange um den Marktbrunnen.
Die Traditionsfledermaus ist die älteste Sigmaringer Fasnetsmaske. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert, als die Fasnet in Sigmaringen reine Männersache war. Doch die Bürgersfrauen hätten es satt gehabt, zu Hause zu bleiben. Sie verkleideten sich, zogen über das schwarze Kleid ein großes Schultertuch und eine Spitzengardine und banden beides zu zwei Fledermausohren.

Bockzunft Stetten a.k.M.
Zentrale Figur der Stettener Fasnet und der Bockzunft ist der Bockstetter „Bock“. Diese Maske zählt zu den schönsten Tiermasken und ist den Weißnarren zuzuordnen. Grundsätzlich ist die Gewandung schaffell-hell, trotzdem springt auch ein schwarzer Bock in der „Bockherde“ mit.
Die Einzelfiguren Hudl-Ann und Johann Jakob Scheiffele verkörpern landschaftsgewachsene, sagenumwobene, typische Heubergoriginale. Der Schäfer, bekleidet in eine echte Heuberg-Schäfer-Montur, hat den pelzgefütterten schweren Mantel lose um die breiten Schultern gelegt.

Narrenzunft Engen
Auf das Jahr 1591 geht aus einem Erlass der erste Beleg für die Engener Fasnet zurück. Aus einem Gerichtsprotokoll von 1618 ist dann auf die Existenz einer Volksfasnet zu schließen.
Das Engener Hansele ist ein klassischer Blätzlenarr, der ursprünglich aus Stoffresten gefertigt wurde. Heute ist er in schwarz und rot gehalten, den Farben, die auch ursprünglich dominant waren. Die Tuchlarve trägt menschliche und tierische Züge. Außerdem ist das Hansele mit vielen kleinen Schellen, einem Fuchsschwanz sowie einer Schweinsblase ausgestattet.

Katzenzunft Meßkirch
Hauptfigur der Meßkircher Fasnet ist die Gestalt der Katze. Sie geht zurück auf Berichte der „Zimmerschen Chronik“. Demnach trieben „Spaikatzen“ schon im 16. Jahrhundert in Meßkirch ihr Unwesen zur Fasnetszeit. 1938 erweckte die Katzenzunft die Figur zu neuem Leben.
Die Katze trägt weite Pluderhosen, das rechte Bein weiß, das linke Bein schwarz. Darauf sind Katzen aufgemalt. Über dem Kittel trägt die Katze einen schwarz-weißen Umhang. Die Spitzen sind mit Schellen besetzt. Die Scheme ist ein aus Lindenholz geschnitzter Katzenkopf.

Poppele-Zunft Singen 1860
Es gibt viele mündlich überlieferte Berichte der Singener Fasnet aus dem 19. Jahrhundert. Namensgeber der Zunft ist Popolius Mayer von der Burg Hohenkrähen, der im 15. Jahrhundert als Schalk und Tunichtgut bekannt war. Er lebte weiter in den Poppelesagen.
Der Hoorige Bär steckt in einem mit Erbsenstroh benähten Häs, das seit 1955 eine Holzmaske ziert. Er stellt den klassischen wilden Mann dar und führt einen knorrigen Stock mit sich. Er trägt eine Stofflarve und eine Saubloder als Neckinstrument.

Narrenzunft Bad Säckingen
Die örtliche Fasnet bezieht sich auf eine Begebenheit vom 1850. Der Schriftsteller und Rechtspraktikant Viktor von Scheffel berichtete von absonderlichen Begebenheiten zur Fasnetszeit. Der Meysenhardt Joggele hat ihm im Wald aufgelauert und ihn in die Irre geführt.
Eben dieses Joggele ist heute die Hauptfigur und der Laufnarr der Bad Säckinger Fasnet. Ihn zieren die Blätter des Waldes und seine Maske zeigt ein knorriges, aber freundliches Gesicht.

Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen
Die Narrenzunft beruft sich auf das Jahr 1503, in dem den Tiengener Zünften von König Maximilian I. das Recht verliehen wurde, an drei Tagen im Jahr die Obrigkeit zu verunglimpfen „ohn der Straf zu gewärtigen”. Das Narrenbrett von 1718 verweist auf diese Begebenheit.
Auf diesem Narrenbrett ist eine Weißnarrenfigur zu sehen, nach der der Katzenrölli gestaltet wurde. Das Häs ähnelt einer Barocken Theaterfigur, besonders sind hier die Kniebundhosen. Sie entstammt vermutlich der italienischen Comedia de l’Arte und trägt eine rote Zipfelmütze sowie eine Rätsche.

Narro Altfischerzunft 1386 Laufenburg
Die Entstehung der Narro-Altfischerzunft geht bis ins Jahr 1386 zurück und wurzelt in der österreichischen Vergangenheit der Stadt Laufenburg. 1924 wurde die damalige Zunft neu gestaltet. Da die Mitglieder inzwischen keine Fischer und Flößer mehr waren, gab man ihr den Namen „Narro-Altfischerzunft“. Die Besonderheit: Die Fasnacht verbindet das badische und das schweizerische Laufenburg. Denn in der Laufenburger Narro-Altfischerzunft 1386 spielen die Ländergrenzen keine Rolle. Hier pflegen Deutsche und Schweizer gemeinsam ein jahrhundertealtes Brauchtum.
Die Mitglieder der Narro-Altfischerzunft nennen sich Zunftbrüder. Der verkleidete Zunftbruder heißt Narro, in der Mehrzahl Narronen. Das Kleid der Narronen besteht aus einer langen Hose und einem hüftlangem Kittel mit weißem Rüschenkragen und weißen Handschuhen. Hose und Kittel bestehen aus Stoffflicken.

Narro-Zunft Waldshut
Die Geltentrommler sind eine Besonderheit aus Waldshut. Das Nachthemd, hier auch Hemdglonker genannt, ist eine traditionelle Form des Narrenhäses. In Waldshut ist auch die Maskierung sehr traditionell. Mit dem Schweineschmalz vom vielen Schlachten an der Fasnet das Gesicht eingeschmiert und mit Mehl bestäubt entsteht eine sehr robuste und entfremdende Maskierung. Getrommelt wird auf Waschzubern, auch Gelten genannt, und zwar mit Kochlöffeln im immer gleichen Takt. Dazu werden Sprüche zum Besten gegeben.
Der Hansele ist ein Blätzlenarr, dessen Häs in gedeckten Raben gehalten ist. Unter dem Spitzhut mit dem Fuchsschwanz trägt er eine Drahtgazemaske, die mit einem Gesicht bemalt wurde. Die Saubloder, die er am Stock mit sich trägt, geht ebenfalls auf das rege Schlachten an der Fasnet zurück.

Althistorische Narrenzunft Narhalla Hechingen
Bereits 1698 erlaubte eine Verfügung vom 6. Januar „den jungen Purschten“ in Stadt und Land das Tanzen „die Fasnet durch“, 1868 veranstaltete die Gesellschaft Narrhalla einen imposanten Fastnachtsumzug, 1924 schließlich wurde die Althistorische Narrenzunft Narrhalla Hechingen gegründet.
Im Vordergrund steht das Pestmännle, das in Verbindung mit dem Roten Butz und unter aktiver Mithilfe aller Schwarzen Butzen sowie den Schalksnarren bei jeglichen Veranstaltungen ein farbenfrohes und turbulentes Spektakel veranstaltet.

Kübelesmarkt Bad Cannstatt
Der Kübelesmarkt Bad Cannstatt e.V. ist besteht seit 1924 und damit genau so lang, wie die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, auch wenn die „Kübler“ erst später VSAN-Mitgliedszunft wurden.
Die Hauptfigur der Cannstatter Fasnet ist die Felbe. Sie entstand 1952 nach einer Ortslegende. Am frühen Morgen, als Nebelschwaden über den Neckar zogen, sah der Wachhabende plötzlich baumlange Kerle am anderen Ufer und die Bürgerwehr rückte todesmutig aus. Als sich der Nebel lichtete, waren die tapferen Cannstatter sehr erstaunt, dass die „Franzosen” nur Felben – der mundartliche Ausdruck für Korbmacherweiden – waren. So kamen die Cannstatter zu dem Necknamen „Felbaköpf”.

Narrenzunft Haigerloch
Die ersten Belege für die Haigerlocher Fasnet stammen aus einem Stadtbüchle von 1457. Zu Zeiten der Gräfin Mechthild, eine Schlüsselfigur der Rottenburger Fasnet, wurde auch in Haigerloch gerne gefeiert.
Die ältesten Masken „Bischöfle“ und „Rottweiler“ stammen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, wodurch sie zu den ältesten Fastnachtsmasken überhaupt gehören.
Hinzu kommt noch der Stadtbutz als Einzelfigur, wobei alle Haigerlocher Narren Butzen sind oder eben Grombiradrucker, ein ortsüblicher Sammelbegriff.

Heimatzunft Hirrlingen
Seit dem 18. Jahrhundert lässt sich die Maskentradition an der Hirrlinger Fasnet nachweisen. Die Butzenzunft wurde dann 1962 gegründet. Heute ist sie Teil der Heimatzunft Hirrlingen, die u. a. auch die Kirbe organisiert.
Der Butz trägt zwei Röcke – einen um die Hüfte und einen über die Schulter geworfen. Er trägt hohe Stiefel und immer einen frischen Tannenzweig oben an der Maske. Seine Begleiterin in die Butzenzuttel, die extra für die Frauen und Mädchen geschaffen wurde und einen Schellenstab mit sich führt.

Hexenzunft Obernheim
Die Hexe ist Hauptgestalt der Obernheimer Fasnetszene aufgrund ihres geschichtshistorischen Hintergrundes ist sie unumstritten. Belege der Hexenfasnet aus dem 19. Jahrhundert finden wir in der Presse und in Kirchenbüchern. Die ersten aus Lindenholz geschnitzten Hexenmasken wurden in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts angefertigt.
Die Obernheimer Hexen, über 800 gestempelte, handgeschnitzte Masken unterscheiden sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild allenfalls durch das auf wenige Farben festgelegte Häs und insbesondere durch Ihr Schultertuch. Handbestickt auf Leinenuntergrund mit Motiven aus der Fasnet, der Gemeinde Obernheim oder der heimischen Flora stellt das Schultertuch eine einmalige Kostbarkeit dar.

Narrenzunft Rottenburg
Eine fastnächtliche Tradition lässt sich in Rottenburg bis zurück in den Anfang des 15. Jahrhunderts nachweisen.
Der Ahland Ist die Hauptfigur der Rottenburger Fasnet. Er kann zur Gattung der Weißbutzen gezählt werden. Zur dämonisch-diabolischen Ahlandmaske stand eine alte, in Stein gehauene Schreckmaske aus der Frührenaissance Modell.
Der historische Teil besteht aus der Gräfin Mechthild, der Gräfin Barbara von Mantua, dem Grafen Eberhard im Barte, dem Hofnarren Halberdrein, Edeldamen und Grafen, dem Rat der Stadt, einer Jägergruppe, Pagen und dem Fahnenschwinger.

Narrenzunft Schömberg
Seit 1922 ist die Narrenzunft Schömberg im Vereinsregister eingetragen. Vor der Vereinsgründung wurde die Fasnet durch die Handwerkszünfte in Schömberg organisiert.
Die Schömberger Fasnet hat neben den bekannten Häser Fransennarr und Fuchswadel noch fünf weitere Häser, die fester Bestandteil der Fasnetstradition sind: Husaren, Harzer, Halbschwarzer, Blätzle und Warz‘. Beim Häs des Fransennar sind zwischen 70 bis 90 Meter lange Wollfransen in einem vorgeschriebenen Muster auf Samt aufgenäht. Die glatte Holzmaske ist an einem mit Wollbollen bestückten Hut befestigt. Der Fuchswadel zählt zu den Weißnarren. Sein Häs ist aus Leinen und handbemalt.

Narrenzunft ``Pfhuser`` Wehingen
Die Narrenzunft Wehingen wurde in ihrer heutigen Form im Jahre 1939 gegründet. Die Vorstände des Turnvereins hatten sich vorgenommen, die bis dahin wilde Fasnet zu organisieren. Das alte Wehinger Fasnetsbrauchtum sollte erhalten und gefestigt werden.
Die heutige Narrenzunft setzt sich zusammen aus Zunftrat, Narren, Harrasweible, den wiedereingeführten Pfhusnarren und Fanfarenzug. Weiterhin gibt es noch eine Einzelfigur, den Pfhus, sowie den großen und den kleinen Briaker.

Narrenzunft Aulendorf
Die Aulendorfer Fastnachtstradition geht auf das 17. Jahrhundert zurück. In einem Dekret des Grafen von Königsegg erlaubte er „einen Tag vor Mittwochen an Fasnachten ein Fasnachtsspill“ zu feiern.
Die Hauptfigur ist die Eckhexe mit ihrem auffallenden seidenen Kopftuch, die mit über 1200 Mitgliedern auch die größte Gruppe bildet. Weiterhin gibt es das Schnörkele und das Fetzle, die für die fastnächtliche Lebensfreude stehen sowie das Maskenpaar Tschorre und Rätsch.

Narrenzunft Henkerhaus Baienfurt
In den 1920er Jahren haben der Nachteulenclub und der Club der Bettschoner die Fasnet in „klein Paris“ wie Baienfurt auch genannt wird, betrieben. Der Name Henkerhaus kommt von einem Wohnhaus für Scharfrichter im Ort, dessen Bewohner mit dem Ruf „Henkerhaus, lass d’Narre raus“ gehänselt wurden.
Der Kardelhannes erinnert an den Kardeanbau, einem distelähnlichen Gewächs, das zum Aufrauen von Stoff verwendet wurde. Dadurch brachten es viele Bauern im Ort zu einigem Reichtum. Die Schleife und die Halskrause des Hannes weisen darauf hin.

Narrenzunft Kißlegger Hudelmale
Die frühesten Dokumente der Kißlegger Fasnet stammen aus dem 16. Jahrhundert. 1875 entstand in Kißlegg der erste „Narrenverein“, die „Gesellschaft Carneval“, der Umzüge und Fasnetsspiele organisierte. Am 13. Mai 1966 wurde der Verein Kißlegger Hudelmale gegründet.
Die Einzelfigur Schnarragagges ist die eigentümlichste Gestalt der Kißlegger Fasnet. Er ist auch der Namensgeber des Kißlegger Narrenrufes „Schnarragagges Heidenei“. Das Markante an der Maske ist die Nase, ein spitz auslaufender Schnörchel mit Luftlöchern und einer kleinen Glocke an der Spitze. Die Eselsohren sind angeschweißt.

Narrenzunft Lindau / Bodensee
In einer um 1300 handgeschriebenen Urkunde wurde beschrieben, dass bereits früher schon die Chorfrauen an der Fastnacht reich bewirtet werden mussten. So weit also reicht die fastnächtliche Geschichte des einzigen Vereinigungsmitgliedes in Bayern zurück. Weitere schriftliche Belege stammen aus späteren Jahrhunderten.
Die Moschtköpf gehen auf die Rebleute im 19. Jahrhundert zurück. Nachdem die Reben von einer Krankheit befallen wurden, mussten sie herausgerissen werden. Die Weinbauern pflanzten stattdessen Obstbäume. Daher die Masken in Apfel- und Birnenform.

Dorauszunft Saulgau 1355
In Notzeiten wurden von vier Stadttoren Sulgens drei geschlossen und beim letzten stand das Wirtshaus Alte Linde. Als im 14. Jahrhundert die Pest wütete, gingen angesehen Bürger vermummt auf Bettelgänge, dadurch entstand der Narrenspruch „Doraus, detnaus, bei d’r alte Linde naus“ und der Dorausschreier.
Die dazu gestaltete Narrenfigur trägte eine Holzmaske mit einer Wurst, einem Fisch oder einem Sauschwänzle im Mund. Dazu einen Strohhut und einen bodenlosen Korb an einem Stab. Sein ärmelloser Überwurf zeigt fastnächtliche Motive und Gebäude der Stadt.

Narrenzunft Tettnang
Die Tettnanger Narrenzunft weist sechs Figuren auf. Der Ur-Hopfennarr, den Hopfennarr, die Hopfensau, die Rote Spinne, das Gätterlet und der Gickeler. Der Urhopfennarr, eine Einzelfigur, hat einen Kittel aus grünen Filz-Hopfenblättern und eine grüne Bundhose. Über den Kopf stülpt er sich eine Haube ohne Maske. Er führt die Hopfennarrengruppe an.
Das Häs des Hopfennarr, ein Weißnarr, ist mit Ranken, Blättern und Hopfen bemalt. Das Hopfennarrentuch besteht aus grünem Filz, die Maske zeigt einen Schalk. Die Hopfensau ist bei Umzügen eine Einzelfigur und trägt einen Saukopf.

Narrenzunft Waldsee
Die Bad Waldseer Fasnet findet ihre ersten Belege im 15. Jahrhundert und ist eine klassische Theaterfasnet. Alleine die mehr als 2700 zugelassenen Masken zeigen, wie gefestigt dieses Brauchtum vor Ort ist.
Der Faselhannes ist eine beeindruckende Weißnarrenfigur mit seinem markanten Gesicht und den beiden buschigen Fuchsschwänzen links und rechts. Das Wort Faseln heißt so viel wie mehrdeutig Aufsagen. Mit ihm zusammen springt der Narro in der Gruppe. Er ist ein freundlicher, bunter Weißnarr.

Wangemer Narrenzunft Kuhschelle Weiß-Rot
Die wichtigsten Häser der Wangemer Narrenzunft wurden in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts geschaffen und im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt. Basierend auf den überlieferten Erzählungen und dem Wissen um die alten Bräuche wurden Figuren entwickelt, die ganz unserem Landschaftsbild und der alten schwäbisch-alemannischen Fasnet entsprechen.

Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten 1348
Das Bild der Weingärtler Fasnet ist geprägt von den Plätzlern. Während die rot-weißen Plätzler nur von Männern getragen werden, können unter roten wie weißen Plätzlern beiderlei Geschlechter stecken. Ein Plätzlerhäs besteht aus Kittel und Hose, die je nach Typ mit 5000 bis 7000 entsprechend gefärbten Filzfleckchen in Dachziegelform bedeckt sind. Die Plätzler tragen eine Holzmaske.
Die originellste und am längsten belegte Figur der Weingärtler Fasnet ist das Fasnetsbutzarössle. Die Rössle zeigen einen Plätzler als Reiter einer Schimmel- oder Rappenattrappe.

Narrenzunft Furtwangen
Im frühen 18. Jahrhundert wird nach einem alten Beleg der „Hirschmendig“ gefeiert, was auf fastnächtliche Aktivitäten schließen lässt. Später organisierten die Furtwanger Vereine die Fastnacht, was sie 1926 aufgrund der Wirtschaftskrise aufgeben wollten. Daraufhin folgte bei großer Beteiligung die Gründung der Narrenzunft.
Der Spättlebue ist die Hauptfigur in Furtwangen und wurde bereits 1875 erwähnt. Die Spättle sind die Stoffflicken, die an sein Häs genäht sind und neben der Holzmaske sind Fuchsschwanz und Saubloder seine Attribute.

Narrenzunft Hausach
1543 soll laut Kinzigtaler Landesordnung die „Faßtnacht als ein heidnische onsinnigkeit …verpoten und abgestellt sin…“
Im 18. Jahrhundert nimmt dann die maskierte Fastnacht ihren Anfang. 1927 dann wird die Narrenzunft gegründet. Der Hansele trägt eine kunstvoll bemalte Maske. In gelb und rot gehalten, trägt er einen Hut mit Fedrewisch. Als Schellnarr trägt er einen Schellenriemen und dazu noch eine Saubloder.

Narrenzunft Hornberg
In Hornberg wird schon lange eine intensive und wilde Fasnet gefeiert. Die ersten schriftlichen Nachweise reichen ins Jahr 1533 zurück. Der Pfarrer hatte alle Bewohner zur Fasnacht eingeladen. Im Jahre 1900 wird erstmals ein Narrenrat erwähnt, der einen Festzug an Fasnacht organisierte. Am 22.März 1935 wurde der Carnevalsverein „Feurio“, der Vorgänger der Narrenzunft Hornberg, gegründet.
Die Zunft hat drei Figuren: die Hornberger Hörner, das Brunnenhansele und der Hofschlurfe. Die Maske der Hornberger Hörner erinnert an die Raubritter aus dem 14. Jahrhundert, die als Teufel verkleidet die Kaufmänner überfielen. Die Hörner beziehen sich aufs Stadtwappen. Das Häs ist in schwarz gehalten, rote Rüschen trennen es von der Maske, sie wiederholen sich in den Armbeugen, Hüften und Knien. Darunter treten Flammenzungen hervor. Ein Lederriemen mit Kuhglocken und ein Dreizack vervollständigen die „Hörner“.

Narrenzunft Triberg
Die Geschichte der Fasnet im Schwarzwald ist auch die Geschichte der Fasnet in Triberg. Denn bereits aus dem Jahre 1525 finden sich Nachweise, dass in Triberg „Narrenkleider“ angefertigt wurden. 1928 wird Narrenzunft Triberg gegründet.
Hauptfigur ist der Teufel. Die Teufelsmaske wurde Ende des 19 Jahrhunderts entwickelt. Ein kupferrot grinsendes Gesicht, Hörner, Stirnhaare und Kinnbart sind schwarz. Dazu trägt er ein rotes Gewand.

Muckenspritzerzunft Mahlstetten
In keine geringe Bestürzung wurden am 17. September 1898 auf dem Feld arbeitende Mahlstetter Einwohner versetzt, als sie in den Vormittagsstunden ihren Kirchturm in eine dichte Rauchwolke eingehüllt sahen. Sie glaubten und mussten glauben, dass im Turm ein Brand ausgebrochen sei, konnten aber trotz eifrigen Rauchsuchens eine Brandstelle in demselben nicht entdecken. Als man dem Turm mit einer Handspritze zu Leib rückte, entpuppte es sich als ein kolossaler Schwarm geflügelter Ameisen, deren Auf- und Niederwogen einem qualmenden Rauch gliech, wie ein Ei dem anderen.
Immer Aktuell
Über uns



Über die Narrenzunft Spritzenmuck
Die Narrenzunft Spritzenmuck wurde 1955 gegründet, doch die Fasnet spielt in Ehingen schon viel länger eine wichtige Rolle. Die früheste Datierung geht dabei auf 1618 zurück. Im Jahr 1934 trat die Narrenzunft der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte (kurz VSAN) bei. Der Zunft liegt die Erhaltung, die Pflege und die Fortentwicklung des im schwäbisch-alemannischen Sprachraums vorhandenen alten Fastnetsbrauchtums sehr am Herzen.